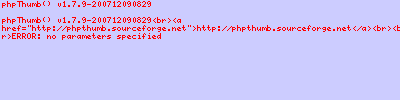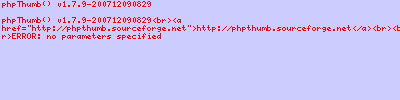Bafin will Sparer für "Zins-Schummelei" sensibilisieren
Die Finanzaufsicht bezieht Position in der Debatte um Prämiensparverträge: Bankkunden sollten die Produkte mit sachkundiger Hilfe auf unwirksame Zinsanpassungsklauseln prüfen lassen, lautet der ungewöhnlich verbraucherfreundliche Rat der Behörde.
Im Dauerstreit um Bonus- oder Prämiensparverträge schlägt sich die Bafin überraschenderweise auf die Seite der Verbraucher. Die Finanzaufsichtsbehörde rät Sparern dazu, die Verträge sorgfältig prüfen oder begutachten zu lassen. Insbesondere sollten Verbraucher nachschauen, ob die Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zur Anpassung der Zinsen rechtskonform sind. "Wichtig ist, dass betroffene Sparer jetzt selbst aktiv auf ihre Institute zugehen und sich erläutern lassen, welche Klausel ihr Vertrag ganz konkret enthält", lässt sich Bafin-Vizepräsidentin Elisabeth Roegele in einer Presseaussendung zitieren.
Der nächste Schritt müsse sein zu prüfen, ob diese Klauseln rechtsgültig sind – auch mithilfe von Verbraucherschützern oder Anwälten. Schließlich geht es um Ansprüche auf mögliche Rückzahlungen in nicht unbeträchtlicher, meistens sogar vierstelliger Höhe, die aber Ende 2020 verjähren könnten. Anfang des Jahres hatte die Bafin die Kreditinstitute aufgefordert, in dieser Frage selbst tätig zu werden und auf Kunden zuzugehen. Offenbar war das zu wenig: Neben dem Aufruf an die Verbraucher prüft die Aufsicht nach eigenen Angaben gegen Banken sogar "konkrete verwaltungsrechtliche Optionen".
Produkte aus den 1990er Jahren
Bei den angesprochenen Verträgen handelt es sich um Sparprodukte, die insbesondere in den 1990er Jahren bis Anfang der 2000er abgeschlossen wurden. Solche Prämiensparverträge sehen vor, dass das Institut dem Kunden zusätzlich zum veränderbaren Zins eine Prämie zahlt: Der Bonus ist nach der Vertragslaufzeit gestaffelt und beträgt bis zu 50 oder sogar 100 Prozent der jährlichen Sparleistung.
Im hartnäckigen Niedrigzinsumfeld versuchen Banken nachvollziehbarerweise, sich dieser alten, hochverzinsten Verträge zu entledigen. Ein Weg ist, die Verzinsung mittels Verweis auf Zinsanpassungsklauseln in den AGB drastisch nach unten anzupassen. Die Sparkasse Leipzig hat beispielsweise im Laufe der Jahre bei ihren Produkten der Serie "Prämienspar flexibel" die jährliche variable Grundverzinsung von anfangs bis zu fünf Prozent auf 0,001 Prozent gekappt.
BGH zückte schon 2004 die rote Karte
Das ist aber seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2004 zufolge unwirksam. Das BGH-Urteil hat allgemeine Anforderungen an die Gestaltung der Zinsanpassungsklauseln aufgestellt. Dennoch gibt es der Bafin zufolge Unsicherheiten, wie Kreditinstitute mit den Anforderungen der BGH-Rechtsprechung umzugehen haben. Ein runder Tisch, den die Aufseher zum Thema Prämiensparen vor kurzem mit Verbänden der Kreditwirtschaft und diversen Verbraucherschutzorganisationen einberufen hatte, habe keine kundengerechten Lösungen gebracht.
Wohin die Reise gehen könnte, zeigt aber ein Urteil, das das Oberlandesgericht (OLG) Dresden im April 2020 im Zuge einer Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen die Sparkasse Leipzig fällte. Das OLG stellte klar, dass die Sparkasse sämtliche nicht korrekt berechnete Zinsen nachzahlen muss. Wie genau der Zinssatz berechnet wird, hat das Gericht in der Verhandlung aber nicht abschließend geklärt. Lediglich, dass die Verzinsung sich an einem angemessenen, langfristigen, öffentlich zugänglichen Referenzzinssatz orientieren muss und monatlich anzupassen ist. Zur Debatte stehen verschiedene langfristige Interbanken-Referenzzinssätze wie Libor oder Euribor, die den Maßgaben des Bundesgerichtshofes aus der Vergangenheit entsprechen müssen. Als angemessen sah das OLG Dresden beispielsweise die neun- bis zehnjährige Zeitreihe der Deutschen Bundesbank "WX 4260" (damalige Bezeichnung) an.
Nächster Halt: Karlsruhe
Die Entscheidung ist bislang nicht rechtskräftig, es wurde Revision beim BGH eingelegt, der die Frage der Zinsberechnung abschließend klären soll. Die Verbraucherzentrale Sachsen geht davon aus, dass die Verhandlung vor dem BGH im kommenden Jahr stattfinden wird.
Bonus-Prämiensparverträge waren aus einem anderen Grund bereits Thema beim BGH. Das oberste deutsche Gericht urteilte 2019 zu der Frage, ob Banken solche Prämiensparverträge mit unbegrenzter Laufzeit von sich aus kündigen dürfen. Das Gericht bejahte das – aber erst nach erstmaligem Erreichen der höchsten Prämienstufe. (jb/ps)