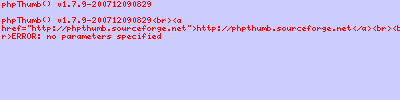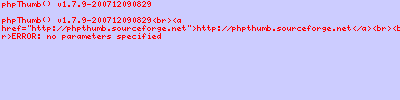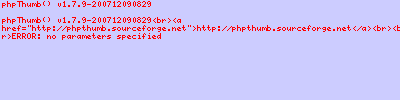Fidelity-Chefin: Branche schießt bei Researchkosten am Ziel vorbei
Abigail Johnson warnt in einem Gastkommentar, dass die Asset-Management-Industrie bei der Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie Mifid II das Gesamtbild aus den Augen verliert. Die Fidelity-Präsidentin plädiert für transparente und faire Gebühren – und einen Umbruch in der Branche.
Die Fondsbranche fokussiert sich bei der Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie Mifid II zu sehr auf den Umgang mit den Kosten für externes Research. Dies meint die Chefin des Asset Management-Hauses Fidelity, Abigail Johnson, in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftszeitung "Financial Times". "Ich unterstütze vollkommen die Ziele neuer Regelwerke wie Mifid II", schreibt die Präsidentin des US-Anbieters. "Aber unsere Industrie verfehlt diese Ziele, indem sie sich fast völlig darauf fokussiert, wie die Kosten für externe Analysen abgerechnet werden."
Eine der Neuerungen der Finanzmarktrichtlinie ist, dass die Fondsanbieter künftig die Ausgaben für Studien Dritter genau aufschlüsseln müssen. Bislang geben Investmentbanken und Broker die Analysen im Gegenzug für Handelsaufträge heraus. Solche Gegengeschäfte erschienen den Regulierern aber zu undurchsichtig. Künftig müssen daher Asset Manager die Kosten für Wertpapiertransaktionen und Research gesondert ausweisen.
Performance-Gebühren sind "unerhört"
"Asset Manager sollten ganzheitlich auf den Geist der Regulierung reagieren", plädiert die Enkelin des Firmengründers Edward C. Johnson II. Die Familie Johnson hält 49 Prozent der Anteile von Fidelity, 51 Prozent liegen bei den Mitarbeitern. Die Managerin macht zwei Stoßrichtungen der neuen Regeln aus: Einerseits sollen die Kosten für Anleger transparenter werden und sinken, andererseits der wirtschaftliche Erfolg der Investmenthäuser an die für die Kunden erwirtschafteten Renditen gekoppelt werden.
Die bisher überwiegende, pauschal an das Volumen eines Fonds gekoppelte Gebühr mache die Branche angreifbar für Vorwürfe, zu viel Geld für eine schwache Leistung einzunehmen, argumentiert Johnson, die Ende vergangenen Jahres komplett die Führung von ihrem Vater übernommen hatte. In einer Welt, in der immer mehr börsengehandelte Indexfonds einen günstige Zugang zur Entwicklung an den Märkten eröffnen, sei dieses Modell nicht mehr zu rechtfertigen. Performance-Gebühren nennt die Fidelity-Chefin gar "noch unerhörter".
Am Ende werden Anleger teuer bezahlen
Stattdessen verweist Johnson auf die "Fulcrum Fee", die der weltweite Unternehmensteil Fidelity International bei einigen Fonds einführen will. Dabei richten sich die Einnahmen des Managers danach, ob das jeweilige Portfolio seinen Vergleichsindex übertrifft oder nicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Performance-Fees schmilzt bei der Fulcrum-Variante aber die Management-Gebühr, sollte die Benchmark nicht übertroffen werden. Die Kostenhöhe ist zudem nach oben wie unten begrenzt.
Mit Blick auf die Kosten für externes Research warnt die Managerin davor, dass Anleger am Ende teuer dafür bezahlen könnten – gerade wenn ihre Fondsmanager die Gebühren auf die eigene Bilanz nehmen. Denn dies könnte zu Einsparungen bei den Analysen führen, was den Investmentprozess und letztendlich die Fondsperformance beeinträchtige. Fidelity weist die Ausgaben für Research den Anlegern zu und stellte sich damit gegen den Trend in der Branche. Neben der Research-Frage verlangten die Aufseher aber auch, die Transaktionskosten zu senken. Transparenz sei hier der Schlüssel zum Erfolg, mahnt die Fidelity-Chefin.
"Wir müssen uns verändern"
Schließlich warnt Johnson, dass zu viele Asset Manager jede Herausforderung des Marktes und der Regulierer einzeln angehen. "Es ist entscheidend, dass wir einen Schritt zurück treten und das ganze Bild betrachten", appelliert Johnson. "Nur die Gesellschaften, die den Mut aufbringen und auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen sowie eine langfristige Perspektive einnehmen, werden sich verändern können. Und verändern müssen wir uns." (ert)





 Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Vortrag am FONDS professionell KONGRESS